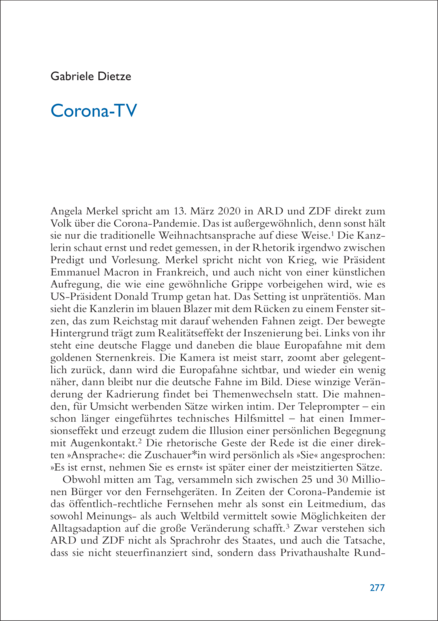Corona-TV
In: Corona: Pandemie und Krise
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2021), pp. 277-287
ISBN 978-3-7425-0714-3
"Schaut man sich die Beispiele des Umgangs mit Corona in den drei behandelten Fernsehformaten – Nachrichten, fiktive Erzählgenres und Corona-Miniserien – an, fällt eine seltsame Ausweichbewegung auf, auch dann, wenn die Pandemie selbst das Thema ist. In den Nachrichten wird die Krankheit durch industrielle, menschenleere Bildarrangements erzählt, im Reich der Serien und Feature-Filme wird sie gleich ganz verschwiegen, und das Nischen-TV der experimentellen Corona-Miniserien zieht sich auf eine Dramedy mit komischer Heldin zurück. In der Erzähltheorie spricht man davon, dass nur mögliche Leben (possible lives) erzählt werden können, weil lediglich im Rahmen der eigenen Kultur und ihrer Vergangenheit ein Verständnis erzeugt werden könne. Dementsprechend scheint im derzeitigen Deutschland auch die Pandemie an die Grenzen der Erzählbarkeit zu stoßen. Covid-19 ist zwar nicht die erste Seuche, die das Abendland heimgesucht hat und erzählt wurde – man denke an die Pest, die Cholera, die spanische Grippe und AIDS –, sie ist aber die erste, die gleichzeitig global verbreitet ist, globalisierte Regime und Abwehrstrategien verlangt und – welch eine Kränkung! – in den demokratischen Nationen schwerer unter Kontrolle zu bringen ist als in einigen autoritären Regimen. Das kulturelle Selbstbewusstsein des Globalen Nordens verlangt, »Herr der Lage« zu sein. Wenn das nicht möglich ist, müssen wenigstens die Opfer unsichtbar bleiben. In den Unterhaltungsgenres, in denen vom besseren Leben geträumt wird und wo das (oft nur zwischenzeitliche) Liebes-Happyend alles wieder gut macht, hat Corona mit seiner Todesdrohung und seiner Berührungslosigkeit keinen Platz. Nur in einem Nischengenre wird ausprobiert, wie ein Leben mit Gesicht, Körper und Corona erzählt werden könnte." (Epilog, Seite 285)