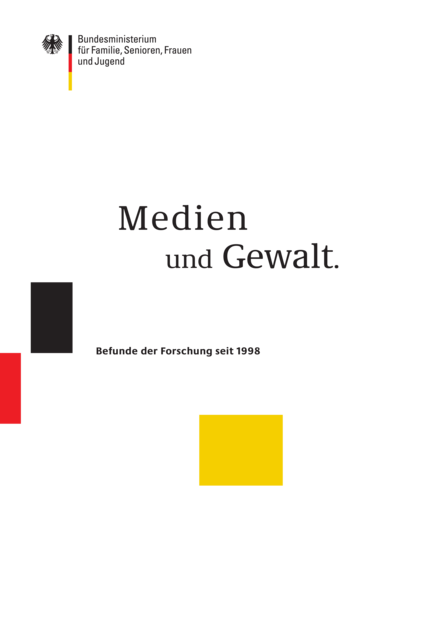Medien und Gewalt: Befunde der Forschung seit 1998
Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2004), 332 pp.
Contains bibliogr. pp. 291-332
"Aufgrund der Komplexität der tatsächlichen Zusammenhänge ist es schwierig, Forschungsergebnisse verständlich zu schildern, ohne zu simplifizieren, aber auch ohne dass in der Vielfalt der Detailergebnisse verallgemeinerbare und praxistaugliche Befunde untergehen. Diese Gratwanderung soll im vorliegenden Bericht unternommen werden. Ziel des Projekts war es, den Forschungsstand nach der letzten größeren, von Michael Kunczik (1998) vorgelegten Bestandsaufnahme zu sichten, zu systematisieren und in verständlicher Weise auf den Punkt zu bringen. Eine solche Arbeit erschien nicht zuletzt deshalb dringlich, weil mittlerweile eine unübersichtliche Vielzahl neuer Studien publiziert wurde. Zwar sind in letzter Zeit auch einige kleinere Übersichten zum Thema erschienen, diese beschränken sich jedoch zumeist auf eine häufig unkritische Wiederholung alter Befunde und beziehen neuere Forschungsergebnisse nur punktuell mit ein.
Für den vorliegenden Bericht wurde eine umfassende Recherche deutsch- und englischsprachiger Untersuchungen durchgeführt, die zwischen 1998 und Ende 2003 erschienen sind. Dabei wurde dem interdisziplinären Charakter der Medien-und-Gewalt-Forschung Rechnung getragen. Das Thema beschäftigt Kommunikationswissenschaftler ebenso wie Psychologen, Pädagogen, Soziologen, Philologen, Filmwissenschaftler und Kriminologen – um nur die wichtigsten Fächer zu nennen. Auch die Medizin, v. a. die Kindermedizin, befasst sich mit den schädlichen Auswirkungen medialer Gewalt. Neben der Recherche von Monographien und Sammelbänden wurden insbesondere die einschlägigen Fachzeitschriften dieser Disziplinen auf Untersuchungen zum Thema „Medien und Gewalt“ hin ausgewertet.
Um die Flut des Materials zu begrenzen und dem eigentlichen Zweck dieses Berichts gerecht zu werden, konzentriert sich die vorliegende Darstellung auf Befunde, die auf empirischen Untersuchungen beruhen, sowie auf theoretische Studien, die zur Interpretation und Integration der in diesen Untersuchungen erzielten Ergebnisse beitragen wollen. Einbezogen wurden sowohl Studien zur fiktiven als auch zur realen Mediengewalt (vgl. Kapitel 2.1), wobei die Untersuchungen zur fiktiven Gewalt jedoch eindeutig überwiegen. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf neuere Forschungsbereiche wie die Computerspielforschung und die Evaluierung medienpädagogischer Maßnahmen gelegt. Ausgeklammert wurde beispielsweise der weite Bereich der als „Betroffenheitsliteratur“ zu bezeichnenden Publikationen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ohne jeglichen Bezug auf empirische Befunde bzw. auf Basis einer unkritischen Rezeption solcher Studien allgemeine und zumeist lediglich von den persönlichen Überzeugungen des Verfassers geprägte bzw. plausibel erscheinende, wissenschaftlich aber nicht abgestützte Betrachtungen der Thematik und allgemeine Ratschläge für das nichtwissenschaftliche Publikum enthalten." (Einleitung, Seite 7-8)
Für den vorliegenden Bericht wurde eine umfassende Recherche deutsch- und englischsprachiger Untersuchungen durchgeführt, die zwischen 1998 und Ende 2003 erschienen sind. Dabei wurde dem interdisziplinären Charakter der Medien-und-Gewalt-Forschung Rechnung getragen. Das Thema beschäftigt Kommunikationswissenschaftler ebenso wie Psychologen, Pädagogen, Soziologen, Philologen, Filmwissenschaftler und Kriminologen – um nur die wichtigsten Fächer zu nennen. Auch die Medizin, v. a. die Kindermedizin, befasst sich mit den schädlichen Auswirkungen medialer Gewalt. Neben der Recherche von Monographien und Sammelbänden wurden insbesondere die einschlägigen Fachzeitschriften dieser Disziplinen auf Untersuchungen zum Thema „Medien und Gewalt“ hin ausgewertet.
Um die Flut des Materials zu begrenzen und dem eigentlichen Zweck dieses Berichts gerecht zu werden, konzentriert sich die vorliegende Darstellung auf Befunde, die auf empirischen Untersuchungen beruhen, sowie auf theoretische Studien, die zur Interpretation und Integration der in diesen Untersuchungen erzielten Ergebnisse beitragen wollen. Einbezogen wurden sowohl Studien zur fiktiven als auch zur realen Mediengewalt (vgl. Kapitel 2.1), wobei die Untersuchungen zur fiktiven Gewalt jedoch eindeutig überwiegen. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf neuere Forschungsbereiche wie die Computerspielforschung und die Evaluierung medienpädagogischer Maßnahmen gelegt. Ausgeklammert wurde beispielsweise der weite Bereich der als „Betroffenheitsliteratur“ zu bezeichnenden Publikationen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ohne jeglichen Bezug auf empirische Befunde bzw. auf Basis einer unkritischen Rezeption solcher Studien allgemeine und zumeist lediglich von den persönlichen Überzeugungen des Verfassers geprägte bzw. plausibel erscheinende, wissenschaftlich aber nicht abgestützte Betrachtungen der Thematik und allgemeine Ratschläge für das nichtwissenschaftliche Publikum enthalten." (Einleitung, Seite 7-8)