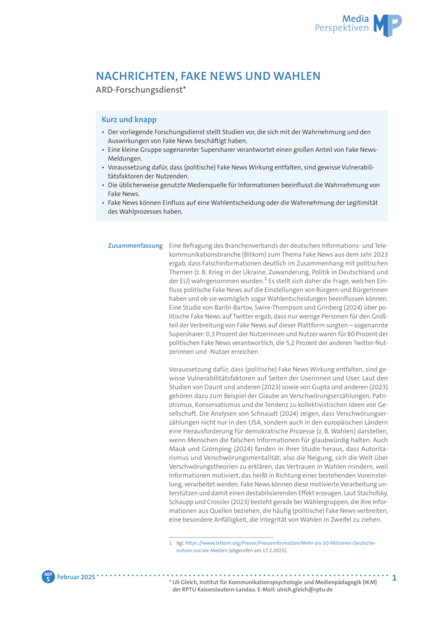Nachrichten, Fake News und Wahlen
Media Perspektiven, issue 5 (2025), 10 pp.
"Voraussetzung dafür, dass (politische) Fake News Wirkung entfalten, sind gewisse Vulnerabilitätsfaktoren auf Seiten der Userinnen und User. Laut den Studien von Daunt und anderen (2023) sowie von Gupta und anderen (2023) gehören dazu zum Beispiel der Glaube an Verschwörungserzählungen, Patriotismus, Konservatismus und die Tendenz zu kollektivistischen Ideen von Gesellschaft. Die Analysen von Schnaudt (2024) zeigen, dass Verschwörungserzählungen nicht nur in den USA, sondern auch in den europäischen Ländern eine Herausforderung für demokratische Prozesse (z. B. Wahlen) darstellen, wenn Menschen die falschen Informationen für glaubwürdig halten. Auch Mauk und Grömping (2024) fanden in ihrer Studie heraus, dass Autoritarismus und Verschwörungsmentalität, also die Neigung, sich die Welt über Verschwörungstheorien zu erklären, das Vertrauen in Wahlen mindern, weil Informationen motiviert, das heißt in Richtung einer bestehenden Voreinstellung, verarbeitet werden. Fake News können diese motivierte Verarbeitung unterstützen und damit einen destabilisierenden Effekt erzeugen. Laut Stachofsky, Schaupp und Crossler (2023) besteht gerade bei Wählergruppen, die ihre Informationen aus Quellen beziehen, die häufig (politische) Fake News verbreiten, eine besondere Anfälligkeit, die Integrität von Wahlen in Zweifel zu ziehen. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass die Herausforderung durch Falschinformationen und Verschwörungserzählungen ironischerweise gerade in denjenigen Ländern hoch ausgeprägt ist, in denen die Rahmenbedingungen für demokratische und unbeeinflusste Wahlen objektiv am günstigsten sind (vgl. auch die Studie von Vliegenthart und anderen, 2024). Und selbst wenn keine tatsächlichen Erkenntnisse über Anomalien bei der Durchführung von Wahlen vorliegen, können Informationen über die Wahrscheinlichkeit von Unregelmäßigkeiten die oben erwähnte motivierte Informationsverarbeitung in Gang setzten und das Vertrauen in die Integrität von Wahlen bedrohen (vgl. die Studie von Kuk, Lee und Rhee (2024)). Studien, die den direkten Einfluss von Fake News auf Wahlentscheidungen untersuchen, sind methodisch schwierig und selten zu finden. Iida und andere (2024) konnten nur geringe Effekte feststellen und betonen, dass eine entsprechende Wirkung eher bei Personen entsteht, die keine ausgeprägten politischen Überzeugungen haben und/oder politisch weniger gut informiert sind. Auch Cantarella, Fraccaroli und Volpe (2023) konnten nur kleine Effekte ermitteln, die jedoch signifikant zum Wahlergebnis zugunsten populistischer Parteien in Italien beigetragen haben." (Zusammenfassung, Seiten 1-2)