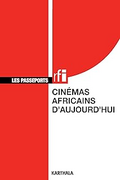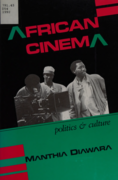Filter
46
Featured
Free Access
9
Top Insights
1
Topics
African Cinema
11
Films
9
Film Distribution
4
Film Industries
4
Latin American Cinema
4
Human Rights Protection & Violations: Media Representation & Reporting
4
Catholic Church & Cinema
3
OCIC - Office Catholique International du Cinéma (1928-2001)
3
Awards & Prizes: Film Awards
3
Film and Religion, Religion in Motion Pictures
3
Documentaries, Television Documentaries, Web Documentaries
3
Signis
2
Faith-Based Film Literacy Education: Catholic Church
2
Ecumenism
2
Faith-Based Film Literacy Education
2
Cinema
2
Asian Cinema
2
Film Actors, Directors & Producers, Filmmakers
2
Religious Films
2
Short Films
2
Film Marketing
2
History of Film & Cinema
2
Media Assistance: Film Funding
2
National Cinemas, National Film Production
2
Television
2
Media Use: Children
1
Book Marketing, Branding & Promotion
1
Book Markets & Industries
1
History of Communication: Catholic Church
1
Children's Television Programmes
1
Interfilm (Protestant Film Organization, 1955-)
1
Arab Cinema, Middle Eastern Cinema
1
Development Education: Films
1
Environmental Films
1
Film Budgeting & Production Costs
1
Ethnographic Films
1
Feature Films
1
Indigenous Films, Indigenous Videos
1
War & Political Violence in Cinema
1
Film Promotion
1
Low-Budget Films
1
Public Film Policies, Film Legislation, Public Film Funding
1
Videos
1
Copyright Law
1
Dealing With the Past
1
Theatre
1
Cultural Identity
1
Culture (General)
1
Literature
1
Development Assistance
1
International Development Cooperation
1
Internet
1
Information Highway
1
LGBT & Communication / Media
1
Television Markets
1
Soap Operas & Telenovelas
1
Environmental & Land Conflicts Reporting & Media Representation
1
Indigenous Communication
1
News Agencies
1
COVID-19 Pandemic: Effects on Journalism, Media & Communication
1
Media, Mass Media
1
Media & Information Literacy
1
Quality Criteria, Quality Standards
1
Starting Media Outlets, Creation of Digital Businesses
1
Migration & Refugees Reporting & (Social) Media Representation
1
Music
1
Press
1
Radio
1
Religion and Communication
1
Judaism and Communication
1
Youth Films & Videos
1
Language
Document type
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Output Type
Afrika Filmfestival Leuven 2008
Kessel Lo: vzw Film en Cultuurpromotie (2008), 130 pp.
Low-Budget Filme: Marketing und Vertrieb optimieren
Konstanz: UVK (2006), 242 pp.
Kirche, Film und Festivals: Geschichte sowie Bewertungskriterien evangelischer und ökumenischer Juryarbeit in den Jahren 1948 bis 1988
Erlangen: Christliche Publizistik Verlag (CPV) (2005), 479 pp.
"Diese Dissertation eröffnet den Leserinnen und Lesern den Zugang zum Film-Engagement der Kirchen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Arbeit evangelischer und ökumenischer Filmjurys wird eingeordnet in die Entwicklung des Films in der Nachkriegszeit und ebenso in das Verhältnis
...
Jewish Film Festival Berlin: Filme, Bilder, Geschichten. Die ersten zehn Jahre
Berlin: be.bra Verlag (2004), 160 pp.
"Nicola Galliner, die Gründerin und Leiterin des Jewish Film Festival Berlin (JFFB), hat nun im Bebra Verlag den Jubiläumsband herausgegeben, um die Geschichte einer Dekade dieses in Deutschland einzigartigen Filmfestes zu gebührend zu würdigen. Verschiedenste Kulturschaffende und Wissenschaftle
...
Afrika Filmfestival
Bruxelles: Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGIS) (2002), 82 pp.
How to Set Up a Film Festival
London: British Film Institute (bfi) (2001), 33 pp.
"How to Set Up a Film Festival has been written in response to the increasing number of film festivals being set up in the UK. It is not exhaustive but is intended to provide a broad framework for planning and to guide you through some of the questions you need to consider when starting out." (Intro
...
Prix de l'OCIC dans les festivals de cinéma: Grands prix de l'OCIC 1947-1966
Bruxelles: OCIC (1999), 69 pp.
abgezoomt - Das Buch zum Festival: Filme, MacherInnen und Entwürfe
München: kopaed (1998), 208 pp.
Film South Asia '97: Festival of South Asian Documentaries. Catalogue
Kathmandu: Himal South Asia (1997), 82 pp.
VIII Festival de Cine de Viña del Mar, Chile 8 al 13 de Enero 1996
Viña del Mar: Festival de Cine (1996), 93 pp.
Afrique, quel marché de la culture? La production et la diffusion des biens culturels et médiatiques de l'Afrique francophone subsaharienne
Paris: Haut Conseil de la Francophonie (1996), 182 pp.
"Examine la production et la distribution de matériel culturel et multimédia en Afrique francophone subsaharienne et l'impact des nouvelles technologies sur les réseaux de communication." (Hans M. Zell, Publishing, Books & Reading in Sub-Saharan Africa, 3d ed. 2008, nr. 378)
Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe: Catálogo de cine y video
Caracas: Biblioteca Nacional (1995), 587 pp.
Sub-Saharan African Films and Filmmakers, 1987-1992: An Annotated Bibliography
London et al.: Hans Zell Publishers (1994), ix, 468 pp.
"The fact that the number of titles from only six years [3.199] almost equals that of the considerably longer reporting period of the basic work [covering the period between 1960 and 1987, published in 1988] demonstrates the proliferation of publications in this field as well. It is an advantage tha
...
African Cinema: Politics and Culture
Bloomington: Indiana University Press (1992), ix, 192 pp.
"Drawing on political science, economics, history, and cultural studies, Diawara provides an insider's account of the development and current status of African cinema. He discusses such issues as film production and distribution, and film aesthetics from the colonial period to the present." (Publish
...
Circuito: Revista trimestral de comunicación y culturas latinas, no. 15
Lima: Unión Latina (1991), 52 pp.
Annuaire - Yearbook - Directorio
Bruxelles: OCIC (1991), 91 pp.