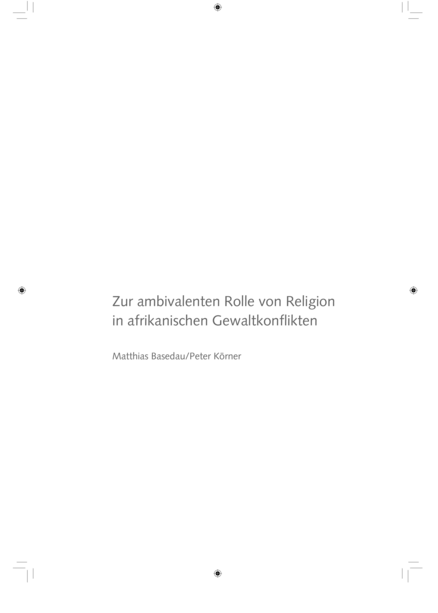Zur ambivalenten Rolle von Religion in afrikanischen Gewaltkonflikten
Osnabrück: Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) (2009), 48 pp.
Contains tables, bibliogr. pp. 34-39
"Die Rolle von Religion in subsaharischen Gewaltkonflikten stellt ein weitgehend vernachlässigtes Forschungsfeld dar, besonders was generalisierende empirische Studien angeht. Eine von der DSF finanzierte Pilotstudie zur Ambivalenz von Religion in Gewaltkonflikten – der ein umfangreicheres Vorhaben folgen soll – näherte sich der Thematik zunächst auf Grundlage einer umfangreichen Bibliographie, der Würdigung des Forschungsstandes und der Entwicklung von Forschungshypothesen an. Mittels der Analyse von vier Variablenclustern, nämlich a) konfliktspezifischen Merkmalen (wie Dauer, Intensität, Konfliktprävalenz), b) klassischen risk factors (wie Armut, ethnische Zersplitterung, vorherige Konflikte), c) religionsdemographischen Merkmalen (wie Anteile und Polarisierungsgrad von Gruppen) und d) Variablen, welche die Rolle von Religion in Gewaltkonflikten beschreiben (wie religiös motivierte Gewalt- oder Friedensaufrufe/Friedensinitiativen, Überlappung von religiösen Identitäten mit Konfliktlinien, Verbindungen von Konfliktparteien und religiösen Organisationen) wurden qualitative fact sheets für 28 Konfliktfälle erstellt und in einer Datenbank erfasst, um sie auch für Korrelationsanalysen und makroqualitative Vergleichsverfahren analysefähig zu machen.
Auf der deskriptiven Ebene bestätigen die Datenbankanalysen eindrucksvoll die Ambivalenz religiöser Faktoren in Gewaltkonflikten: In 19 von 28 Fällen konnten eskalierende und deeskalierende Elemente entdeckt werden, in sechs weiteren Fällen ausschließlich Deeskalation. Religion spielt damit in insgesamt 25 der 28 Fälle und damit weitaus häufiger eine Rolle als gemeinhin angenommen, auch wenn theologische Inhalte bzw. Ideen in maximal acht Fällen als Teilursachen in Betracht kommen (v.a. Sudan, Nordnigeria und Somalia). Bivariate Analysen und makroqualitative Vergleiche zeigen, dass zahlreiche religiöse Variablen einen signifikanten Einfluss auf die Konfliktwahrscheinlichkeit nach 1990 bzw. auf das Andauern des Konflikts haben (bei der Konfliktintensität sind die Ergebnisse nicht robust und für die Konfliktdauer gibt es keine Zusammenhänge). Die Überlappung religiöser und anderer Identitäten erweist sich als ähnlich einflussreich und signifikant wie Verbindungen von religiösen Organisationen und Konfliktparteien sowie der eskalierende Gebrauch religiöser Ideen durch religiöse und politische Führer (v.a. Gewaltaufrufe). Obwohl Friedensaufrufe und -initiativen häufiger beobachtbar sind, kann für sie – ebenso wie für die Existenz interreligiöser Netzwerke – kein positiver Einfluss auf Frieden festgestellt werden. Nicht-religiöse Risikofaktoren ergeben dagegen starke Zusammenhänge (v.a. Einkommen, vorheriger Konflikt, ethnische Fragmentierung), die insgesamt etwas stärker sind als die Korrelationen mit religiösen Faktoren. Unterstützung gibt es schließlich für eine „Mobilisierungsthese“: Makroqualitative Vergleiche zeigen, dass religiös begründete Gewaltaufrufe besonders dann wahrscheinlich sind, wenn religiöse mit anderen sozialen Identitäten und den Konfliktlinien parallel verlaufen und Beziehungen zwischen den Konfliktparteien und religiösen Organisationen bestehen." (Zusammenfassung)
Auf der deskriptiven Ebene bestätigen die Datenbankanalysen eindrucksvoll die Ambivalenz religiöser Faktoren in Gewaltkonflikten: In 19 von 28 Fällen konnten eskalierende und deeskalierende Elemente entdeckt werden, in sechs weiteren Fällen ausschließlich Deeskalation. Religion spielt damit in insgesamt 25 der 28 Fälle und damit weitaus häufiger eine Rolle als gemeinhin angenommen, auch wenn theologische Inhalte bzw. Ideen in maximal acht Fällen als Teilursachen in Betracht kommen (v.a. Sudan, Nordnigeria und Somalia). Bivariate Analysen und makroqualitative Vergleiche zeigen, dass zahlreiche religiöse Variablen einen signifikanten Einfluss auf die Konfliktwahrscheinlichkeit nach 1990 bzw. auf das Andauern des Konflikts haben (bei der Konfliktintensität sind die Ergebnisse nicht robust und für die Konfliktdauer gibt es keine Zusammenhänge). Die Überlappung religiöser und anderer Identitäten erweist sich als ähnlich einflussreich und signifikant wie Verbindungen von religiösen Organisationen und Konfliktparteien sowie der eskalierende Gebrauch religiöser Ideen durch religiöse und politische Führer (v.a. Gewaltaufrufe). Obwohl Friedensaufrufe und -initiativen häufiger beobachtbar sind, kann für sie – ebenso wie für die Existenz interreligiöser Netzwerke – kein positiver Einfluss auf Frieden festgestellt werden. Nicht-religiöse Risikofaktoren ergeben dagegen starke Zusammenhänge (v.a. Einkommen, vorheriger Konflikt, ethnische Fragmentierung), die insgesamt etwas stärker sind als die Korrelationen mit religiösen Faktoren. Unterstützung gibt es schließlich für eine „Mobilisierungsthese“: Makroqualitative Vergleiche zeigen, dass religiös begründete Gewaltaufrufe besonders dann wahrscheinlich sind, wenn religiöse mit anderen sozialen Identitäten und den Konfliktlinien parallel verlaufen und Beziehungen zwischen den Konfliktparteien und religiösen Organisationen bestehen." (Zusammenfassung)
1 Einführung und Problemstellung, 6
2 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse, 7
3 Schlussfolgerungen, 32
4 Literaturangaben, 34
5 Anhang, 40
2 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse, 7
3 Schlussfolgerungen, 32
4 Literaturangaben, 34
5 Anhang, 40