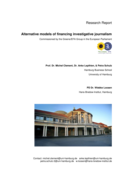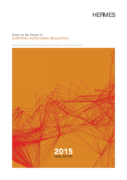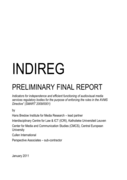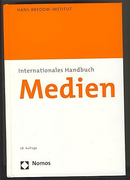Filter
31
Text search:
Hans-Bredow-Institut
Featured
Free Access
9
Quick Overview
1
Top Insights
2
Topics
Media Landscapes, Media Systems, Media Situation in General
10
Media Law & Regulation
9
Audiences & Users
8
Internet
7
Radio Landscapes
6
Transnational Broadcasting, International Broadcasting
5
Media & Communication Policies
5
Television Landscapes
5
Radio
5
Television
5
Economics of Media
4
International Communication
4
Press Landscapes
3
Television Channels
3
Television Programmes & Genres
3
Advertising Markets & Industries
2
Online Services
2
Media Industries
2
Satellite Television
2
Broadcasting Companies
2
Media Outlets, Media Associations
2
Propaganda
2
Satellite Radios
2
Digital Television
2
Radio Broadcasting Equipment & Technologies
2
Television Transmitters
2
Audience Segmentation, User Typologies, Personas
1
Digital & Social Media Use, Internet Use
1
Digital & Social Media Use: Youth
1
Media Use, Media Consumption
1
News Consumption & Information Sources of Media Users
1
Communication Rights
1
Freedom of Expression Online, Internet Freedom
1
Extremist & Terrorist Communication Strategies and Media
1
Contents of Media
1
Digital Media Landscapes
1
Internet and Society / Social Change
1
Disinformation, Misinformation, Fake News
1
Countering Hate Speech, Disinformation & Propaganda
1
Disinformation & Misinformation Law & Regulation
1
Environmental Disinformation & Misinformation
1
Economy
1
History of Media & Communication
1
History of Radio
1
Nazism
1
Globalisation: Impact on (Local) Media & Communication
1
International Media & Communication Policies
1
International Radio Broadcasting, Foreign Radio Broadcasting
1
Transnational Journalism Cooperation & News Exchange
1
Transnational Media Corporations, International Media Companies
1
Journalism
1
Financing Journalism
1
Investigative Journalism
1
Journalists: Professional Identity & Values
1
Television News
1
Working Conditions of Journalists & Media Personnel
1
Media Assistance
1
Media, Mass Media
1
Public Funding & Support Policies for Media
1
Regulatory Bodies
1
Deutsche Welle
1
Friedrich Ebert Foundation
1
People with Disabilities: Access to & Use of ICT and Media
1
People with Disabilities: Tailored ICT & Media Products
1
Political Doctrines
1
Democracy / Democratization and Media
1
Media Psychology, Communication Psychology
1
Technologies, Information & Communication Technologies
1
Informatics
1
Telecommunications
1
Language
Document type
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Methods applied
Output Type
Destruktive Diskurse: Digitale Verbreitung von klimabezogener Mis- und Desinformation
Berlin; Hamburg: Institute for Strategic Dialogue (ISD);Hans-Bredow-Institut (2025), 52 pp.
Assessing Internet Development in Germany: Using UNESCO's Internet Universality ROAM-X Indicators
Paris; Hamburg: UNESCO;Leibniz Institute for Media Research, Hans-Bredow-Institut (2023), 258 pp.
"Verständlicher, nicht so politisch": Einblicke in die Bedürfnisse und Nutzungspraktiken gering informationsorientierter junger Menschen
Hamburg: Hans-Bredow-Institut (2023), 53 pp.
"Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es eine zunehmend große Gruppe, die ein geringes Interesse am aktuellen Weltgeschehen hat, kaum Informationsangebote etablierter Medien nutzt und mit journalistischen Angeboten entsprechend kaum noch erreicht werden kann: die gering Informationsorient
...
Journalismus in Deutschland 2023: Aktuelle Befunde zu Situation und Wandel
Hamburg: Hans-Bredow-Institut (2023), 16 pp.
"Dieses Arbeitspapier präsentiert erste Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von insgesamt 1.221 Journalist:innen in Deutschland, die zwischen September 2022 und Februar 2023 durchgeführt wurde. Die Studie, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, ist Teil des Forschung
...
Desinformation: Risiken, Regulierungslücken und adäquate Gegenmaßnahmen
Top Insights
Düsseldorf: Landesanstalt für Medien NRW;Hans-Bredow-Institut (2021), 97 pp.
"Auf der Grundlage der identifizierten Schutzlücken erarbeitet das Gutachten mögliche Gegenmaßnahmen und beschreibt die nötigen Wirkungsvoraussetzungen. Die zentrale Frage lautet: Welche Risikopotenziale für individuelle und gesellschaftliche Interessen weist Desinformation auf und welche Gover
...
Alternative Models of Financing Investigative Journalism
Top Insights
Hamburg: University of Hamburg, Hamburg Business School;Hans-Bredow-Institut (2018), 42 pp.
"This report aims to identify, evaluate, and discuss models to finance investigative journalism in the EU. To provide a thorough evaluation, we developed a set of criteria that cover six areas to that the financial source may exert an influence from high to low degrees. Those are (1) Independence, (
...
Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen: Forschungsbericht
Berlin; Bonn; Dortmund; Hamburg: Die Medienanstalten;Aktion Mensch;Technische Universität Dortmund;Hans-Bredow-Institut (2016), 150 pp.
"Insgesamt wird deutlich, dass mit einer Beeinträchtigung weiterhin spezifische Risiken in der Mediennutzung durch Zugangs- und Teilhabebarrieren einhergehen. Die bedeutsamsten Handlungsfelder für die Gestaltung von Inklusionsprozessen durch mediale Teilhabe und die größten Handlungsbedarfe aufg
...
Study on the Future of European Audiovisual Regulation
Hamburg; Amsterdam: Hans-Bredow-Institut;University of Amsterdam, Institute for Information Law (IViR) (2015), 68 pp.
"This report recommends the use of opt-in regulation that offers favourable terms for the provision of content of ‘public value’. This approach will ensure that common European aims and values are maintained and national cultural particularities respected in a stable and long-lasting regulatory
...
INDIREG Preliminary Final Report: Indicators for Independence and Efficient Functioning of Audiovisual Media Services Regulatory Bodies for the Purpose of Enforcing the Rules in the AVMS Directive (SMART 2009/0001)
Hamburg; Leuven: Hans-Bredow-Institut;Center for Media and Communication Studies (CMCS), Central European University;Katholieke Universiteit Leuven, Interdisciplinary Centre for Law & ICT (ICRI) (2011), 417 pp.
"The study has three general objectives: (1) A detailed legal description and analysis of the audiovisual media services regulatory bodies in the Member States, in candidate and potential candidate countries of the European Union and the EFTA countries, as well as four non-European countries; (2) an
...
Internationales Handbuch Medien
Quick Overview
Christiane Matzen; Anja Herzog (eds.)
Baden-Baden: Nomos, 28th ed. (2009), 1308 pp.
Mediennutzung im internationalen Vergleich
In: Internationales Handbuch Medien
Hans-Bredow-Institut (ed.)
Baden-Baden: Nomos, 28. Aufl. (2009), pp. 131-155
Medien von A bis Z
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2006), 411 pp.
Internationales Handbuch Medien 2004/2005
Baden-Baden: Nomos, 27th ed. (2004), 1200 pp.
Mediennutzung im internationalen Vergleich
In: Internationales Handbuch Medien 2004/2005
Hans-Bredow-Institut (ed.)
Baden-Baden: Nomos (2004), pp. 136-158
Internationales Handbuch Medien 2002/2003
Baden-Baden: Nomos, 26th ed. (2002), 1056 pp.
Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen 2000/2001
Baden-Baden: Nomos (2000), 926 pp.
Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen 1998/1999
Baden-Baden: Nomos (1998), 830 pp.
Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen 1996/1997
Hamburg: Hans-Bredow-Institut (1996), 229, 383, 355, 173, 90, 171 pp.
TV auf dem Balkan = TV in the Balkans
Hamburg: Hans-Bredow-Institut (1996), 173 pp.
Radio auf dem Balkan: Zur Entwicklung des Hörfunks in Südosteuropa
Hamburg: Hans-Bredow-Institut (1995), 190 pp.