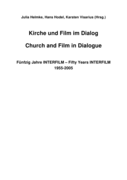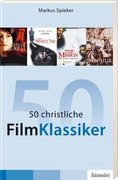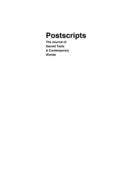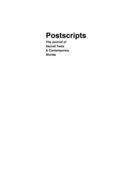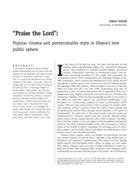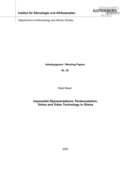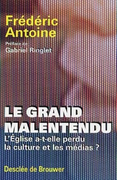Filter
161
Featured
Free Access
16
Key Guidance
1
Top Insights
3
Topics
Film and Religion, Religion in Motion Pictures
51
Religious Films
39
Bible Films, Movie Christs & Antichrists
27
Christian Films & Videos
25
Catholic Church & Cinema
22
Film and Spirituality
19
Catholic Films
14
OCIC - Office Catholique International du Cinéma (1928-2001)
10
Faith-Based Film Literacy Education: Catholic Church
10
Religion and Communication
10
Hinduism and Communication
10
Film Festivals
9
Bible, Biblical Theology
8
Pentecostal Churches & Communication
8
Communication Pastoral, Media Pastoral
7
Catholic Church: Media Representation & Reporting
6
Cinema
6
Buddhism and Communication
6
Awards & Prizes: Film Awards
5
Videos
5
Mythology & Communication, Media Myths
5
Muslim Cinema & Film Representation of Islam
5
Catechetical Materials: Catholic Church
4
History of Communication: Catholic Church
4
Christian Communication
4
Gender & Religious Communication
4
Islam and Communication
4
Catholic Church and Communication
3
Signis
3
Church Documents on Communication
3
Faith-Based Media Literacy Education: Catholic Church
3
Old Testament
3
Protestantism (Mainline)
3
Clergy, Bishops, Priests
3
Faith-Based Film Literacy Education
3
Missionary Communication, Media & Evangelisation
3
Theologies of Communication
3
Aesthetics in Film & Visual Communication
3
Film Actors, Directors & Producers, Filmmakers
3
Religious Functions & Messages of the Media
3
Ethical Learning: Use & Role of Media
3
Media in Religious Education
3
Demons, Ghosts, Supernaturals & The Evil in the Media
3
Indigenous & Traditional Religions, Indigenous Cosmovisions
3
Judaism and Communication
3
film-dienst (Film Journal, Germany, 1947-)
2
UNDA (International Catholic Radio and TV Association, 1928-2001)
2
Church Calendar
2
Mary, Mariology
2
Apocalypse
2
Evangelical Churches
2
Interfilm (Protestant Film Organization, 1955-)
2
Christian Symbols
2
Christianity: Media Representation & Reporting
2
Ecumenism
2
Feature Films
2
Film Literacy
2
Film Reception & Effects
2
Films
2
Storytelling
2
Religious Functions & Messages of Digital Media
2
Literature
2
Popular Religious Cultures & Practices
2
Education and Communication / Media
2
Religion: Media Representation
2
Judaism: Media Representation & Reporting
2
Afterlife, Immortality, Resurrection: Media Representation
2
Esotericism & New Age
2
Interreligious Dialogue
2
Spirituality
2
Posters
1
Audiences & Users
1
Film Audiences, Film Consumption
1
Catholic Church
1
Catholic Television Programmes
1
Catholic Media Organizations
1
Divine Word Missionaries (SVD)
1
Jesuits
1
Catholic Theology
1
Christmas
1
Popes & Papacy
1
Saints
1
Animated Cartoons, Animated Films
1
Children's Films
1
Comics, Cartoons, Caricatures
1
Religious Contents & Meanings in Cartoons & Comics
1
Media Literacy: Children
1
New Testament
1
Catechetics
1
Christian Churches: Communication Education & Training
1
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)
1
Christian Communication Ethics, Christian Media Ethics
1
Christian Radio Programmes
1
Christian Television
1
Christian Television Programmes
1
Televangelism
1
Evangelisation
1
Holy Mass
1
Mission
1
Prayers
1
Salvation (Religion)
1
Theologies
1
The Ten Commandments
1
Asian Cinema
1
Celebrities, Idols, Stars
1
Film Censorship
1
Film & Gender
1
Film and Development
1
Film and Society
1
Film Criticism
1
Film Culture
1
Documentaries, Television Documentaries, Web Documentaries
1
Educational Films & Videos
1
Horror Films
1
Film Industries
1
Bollywood
1
Film Studies & Research
1
Film & Video in Education
1
Films in Health Communication
1
History of Film & Cinema
1
National Cinemas, National Film Production
1
Group Media
1
Oral Cultures & Traditions, Oral History, Oral Testimonies
1
Genocides
1
Holocaust
1
Religion and Conflicts, Religious Conflicts, Religious Violence
1
Trauma, Coping with Trauma, Trauma Therapy
1
Media Ethnography
1
Collective Memory: Violent Conflicts & Wars
1
Cultural Identity
1
Cultural Studies
1
Religious Literature & Religious Motifs in Literature
1
Popular Cultures
1
Religion and Culture
1
Religious Music
1
Funding Criteria & Priorities
1
Development Communication, Communication for Development (C4D)
1
Development and Media
1
Rural Communication for Development
1
Digital Media, Internet & Religion
1
Cyberfaith / Virtual Spirituality
1
Internet
1
Church Archives
1
Audiobooks & Audio Cassettes
1
Educational Broadcasting
1
Schools
1
Filmstrips (Still Image Instructional Media)
1
Media Didactics, Media Use in Education
1
Nonformal Education
1
Entertainment and Media / Communication
1
Soap Operas & Telenovelas
1
Television Dramas
1
Television Serials
1
Defamation of Religion (Blasphemy)
1
Feminism & Communication
1
Gender Representation & Stereotypes in the Media
1
Mental Health Reporting & Media Representation
1
Colonial Period
1
Islam: Media Representation & Reporting
1
Presentation of Information
1
Media & Information Literacy
1
Media Law & Regulation: Muslim Countries
1
Quality Criteria, Quality Standards
1
Wenders, Wim
1
National Identity & Media, Nationalism & Communication
1
Radio
1
Emotions in Communication & Media
1
Media Effects
1
Asian Religions
1
Islamic Cultures: Role of Media
1
Muslim Media
1
Religion and Politics
1
Religion and Society
1
Religion in Entertainment Programmes (Religiotainment)
1
Religious Communication Research
1
Sense of Life
1
Symbols: Religious
1
Rural Issues: Media Representation & Reporting
1
Reality & Communication, Truth & Media
1
Traditional Society
1
Television
1
Rede Record (Television Channel, Brazil)
1
Audio Slide Shows, Sound Image Shows
1
Audiovisual Communication
1
Signs, Signals, Semiotics
1
Slides, Slideshows
1
Visual Representations
1
Language
Document type
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Methods applied
Journals
Output Type
Filming the Gods: Religion and Indian Cinema
London: Routledge (2006), x, 198 pp.
"Filming the Gods examines the role and depiction of religion in Indian cinema, showing that the relationship between the modern and the traditional in contemporary India is not exotic, but part of everyday life. Concentrating mainly on the Hindi cinema of Mumbai, Bollywood, it also discusses India'
...
The Bible in Film - the Bible and Film
Leiden; Boston: Brill (2006), vii, 190 pp.
"There are films that retell biblical narratives and there are films that allude to the Bible or otherwise build on or appropriate biblical themes and images. The eleven lively and provocative articles in this volume explore both types of film, showcasing the cinema's impact on the perception of the
...
Kirche und Film im Dialog: Fünfzig Jahre INTERFILM 1955-2005 = Church and Film in Dialogue: Fifty Years INTERFILM 1955-2005
Frankfurt am Main: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) (2005), 165 pp.
"Founded on the 22nd of October, 1955, in Paris, by pioneers of Protestant film work, INTERFILM is an international network of Church film and media institutions as well as dedicated individuals with the goal of coordinating dialogues between Church and film. Directed by the terms and aims of the Wo
...
Saints, Clergy and Other Religious Figures on Film and Television: 1895-2003
Top Insights
Jefferson: McFarland (2005), 192 pp.
Cinéma Divinité: Religion, Theology and the Bible in Film
London: SCM (2005), xvii, 373 pp.
Muslim Martyrs and Pagan Vampires: Popular Video Films and the Propagation of Religion in Northern Nigeria
Postscripts, volume 1, issue 2-3 (2005), pp. 183-205
"In December 2000 the government of Kano State in Muslim northern Nigeria reintroduced shari’a and established a new board for film and video censorship charged with the responsibility to “sanitize” the video industry and enforce the compliance of video films with moral standards of Islam. Sta
...
50 christliche Film-Klassiker
Holzgerlingen: Hänssler (2005), 115 pp.
Kirche, Film und Festivals: Geschichte sowie Bewertungskriterien evangelischer und ökumenischer Juryarbeit in den Jahren 1948 bis 1988
Erlangen: Christliche Publizistik Verlag (CPV) (2005), 479 pp.
"Diese Dissertation eröffnet den Leserinnen und Lesern den Zugang zum Film-Engagement der Kirchen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Arbeit evangelischer und ökumenischer Filmjurys wird eingeordnet in die Entwicklung des Films in der Nachkriegszeit und ebenso in das Verhältnis
...
Mediating Religion and Film in a Post-Secular World
Postscripts, volume 1, issue 2-3 (2005), pp. 149-347
[Religious Film]
Postscripts, volume 1, issue 2-3 (2005), pp. 149-374
Die Erotik des Bösen: Mami Water als "christlicher" Dämon in ghanaischen und nigerianischen Videos
In: Africa screams: Das Böse in Kino, Kunst und Kult
Wuppertal: Peter Hammer Verlag (2004), pp. 199-209
"Praise the Lord": Popular Cinema and Pentecostalite Style in Ghana’s New Public Sphere
American Ethnologist, volume 31, issue 1 (2004), pp. 92-110
"In this article I examine the elective affinity between Pentecostalism and the vibrant video-film industry that has flourished in the wake of Ghana’s adoption of a democratic constitution. I argue that, as a result of the liberalization and commercialization of the media, a new public sphere has
...
Popularkino als Ersatzkirche? Das Erfolgsprinzip aktueller Blockbuster
Münster: Lit (2004), 416 pp.
"Die Autorin untersucht aktuelle Blockbuster-Filme, um zu allgemeingültigen Erfolgskriterien für Popularfilme zu gelangen. Dabei wird aufgezeigt, daß Blockbuster unsere Sehnsüchte, Wünsche und Ängste unter Zuhilfenahme mythisch-symbolischer Gestaltungselemente beantworten. Zudem fungieren die
...
Jewish Film Festival Berlin: Filme, Bilder, Geschichten. Die ersten zehn Jahre
Berlin: be.bra Verlag (2004), 160 pp.
"Nicola Galliner, die Gründerin und Leiterin des Jewish Film Festival Berlin (JFFB), hat nun im Bebra Verlag den Jubiläumsband herausgegeben, um die Geschichte einer Dekade dieses in Deutschland einzigartigen Filmfestes zu gebührend zu würdigen. Verschiedenste Kulturschaffende und Wissenschaftle
...
Wenn Gott ins Kino geht: 50 Filme, die man kennen muss
Wuppertal: Brockhaus (2004), 224 pp.
Jesus at the Movies: A Guide to the First Hundred Years
Santa Rosa, Calif.: Polebridge Press, revised and expanded ed. (2004), xiv, 293 pp.
"Since the earliest days of the movies more than a century ago, moviemakers have been intrigued by "the greatest story ever told." They have tried, with varying degrees of success, to capture the life of Jesus on film. In Jesus at the Movies Barnes Tatum has created a fascinating and exhaustively-re
...
Impossible Representations: Pentecostalism, Vision and Video Technology in Ghana
Mainz: Universität Mainz, Institut für Ethnologie und Afrikastudien (2003), 22 pp.
"In this essay I have tried to show how, by taking as point of departure an understanding of religion as a practice of mediation, Pentecostalism has increasingly ‘taken place’, so to speak, in the public sphere as a result of Ghana’s turn to democracy and the liberalization and commercializati
...