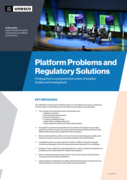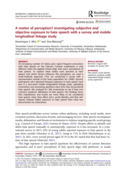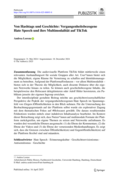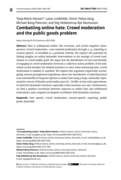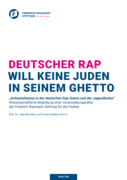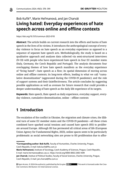Filter
423
Featured
Free Access
334
Key Guidance
10
Top Insights
23
Topics
Hate Speech, Hate Speech in Social Media
150
Countering Hate Speech, Disinformation & Propaganda
143
Extremist & Terrorist Digital / Social Media Presence
108
Extremist & Terrorist Communication Strategies and Media
55
Disinformation, Misinformation, Fake News
42
Islamic State (Political-Religious Extremist Organization)
32
Hate Speech Legislation & Regulation
29
Islamist Communications & Media
29
Content Moderation & Regulation: Social Media
26
Radicalisation: Influence of Media
24
Extremist Recruitment through Media
19
Facebook
16
Information Warfare, Psychological Warfare
15
Right-Wing Extremism
14
Propaganda
14
Antisemitism
14
Twitter & Microblogs
12
Jihad
12
Extremism & Terrorism Reporting
9
Nazism
9
Taliban
9
Digital Activism, Cyber Advocacy
8
Digital Platforms & Intermediaries
8
Telegram
8
Harassment & Intimidation of Journalists
7
Digital Platform & Intermediaries Regulation
7
Countering Defamation & Harassment
7
Gender-Based Online Harassment & Sexual Threats
7
Fundamentalisms (Religious)
7
Freedom of Expression
6
Cyberbullying, Cyberharassment
6
Social Media
6
Racism in Communication & Media
6
Racism in Social Media & Digital Communication
6
Disinformation & Misinformation Law & Regulation
6
Islam: Media Representation & Reporting
6
Migration & Refugees Reporting & (Social) Media Representation
6
Radio-Télévision Libre des Milles Collines (RTLM)
6
Genocides
5
Terrorism
5
Boko Haram
5
Civil Wars
5
Media Assistance in Conflict Regions & Fragile Countries
5
Social Media in Political Communication
5
TikTok
5
Media Literacy: Disinformation, Fake News, Hate Speech
5
Good Practice Examples
5
Political Extremism
5
Political Communication
5
Censorship
4
Religion and Conflicts, Religious Conflicts, Religious Violence
4
Conflict Reporting, Armed Conflict Reporting
4
Conflict-Sensitive / Peace Communication
4
Conflicts & Wars: Roles of Digital Technologies & Conflict Narratives in Social Media
4
Cyberwarfare, Cyber Operations: Attacking Enemy Computers, Software, and Control Systems
4
War Propaganda, Propaganda in Conflicts
4
Narratives, Narrative Structures
4
Digital Ethics, AI Ethics, Social Media Ethics, Data & Information Ethics
4
Digital & Information Literacy
4
Discrimination in Language & Media
4
Conspiracy Narratives, Conspiracy Theories
4
Defamation Law & Regulation
4
Gender-Based Harassment, Intimidation & Violence
4
Human Rights
4
Polarization, Political Polarization
4
Press
4
Radio
4
Visual Communication
4
Digital & Social Media Use: Youth
3
Gaming: Uses & Effects
3
Trust in the Media, Credibility of Media
3
Authoritarian Regimes: Government Communication Strategies
3
Campaigning: Evaluation, Monitoring, Impact Assessment
3
Digital Media Censorship, Control & Filtering, Internet & Social Media Censorship
3
Government Propaganda
3
Public Diplomacy, Cultural Diplomacy
3
Holocaust
3
Perpetrators
3
Russia-Ukraine War <2014-
3
Conflict-Sensitive Digital Technology Use & Social Media in Prevention & Transformation
3
Internet / ICTs and Conflicts
3
Religious Communication in Conflicts & Peacebuilding
3
Countering Misinformation & Rumours
3
Big Digital Platforms, Big Tech Companies
3
Internet / Social Media Law & Regulation
3
Political Blogging
3
YouTube
3
Romani People
3
Foreign Disinformation, Foreign Information Manipulation Operations, Foreign Propaganda
3
Documenting Human Rights Violations
3
Fact-Checking & Verification of Sources
3
Digital Literacy: Youth
3
Media Literacy: Youth
3
Media Law & Regulation
3
Political Parties: Communication Strategies
3
Persuasive Communication
3
Islamism
3
Internet Service Providers (ISPs)
3
Civic Engagement, Citizen Participation, Civil Society & Digital Communication
2
Digital & Social Media Use, Internet Use
2
Textbooks, Textbook Development, Publishing & Research
2
Campaigning: Experiences
2
Campaigning: Message Design
2
Campaigning: Planning & Implementation
2
Catholic Communicators & Journalists
2
Catholic Radio Programmes
2
Cybersecurity, Digital Safety, Privacy, Right to Privacy
2
Media Freedom, Press Freedom
2
Government Communication Strategies
2
Storytelling
2
Conflicts and Media
2
Conflict-Sensitive & Peace Journalism
2
Conflict-Sensitive Radio Journalism, Radio in Conflict Prevention & Transformation
2
Dealing With the Past
2
Enemy Images
2
Foreign Conflict Reporting, International War Reporting
2
Violence in the Media: Video Games
2
War Reporting
2
Rumours & Rumour Management
2
Collective Memory & Media, Media Representation of History
2
Memes
2
Edutainment Television Programmes
2
Internet Effects
2
Political Websites & Online Communities
2
Search Engines
2
Democratization & Digital Media / Social Media
2
Filter Bubbles & Echo Chambers
2
Instagram
2
Artificial Intelligence
2
Digitalisation, Online Communication & Democracy / Democratization
2
Minorities & Disadvantaged Groups: Media Policies & Regulations
2
Xenophobia
2
Disaster & Humanitarian Crisis Communication
2
Election Campaigns: Disinformation & Misinformation
2
Gaming, Video Games
2
Sports Reporting
2
Ethics in Media & Communication
2
Defamation of Religion (Blasphemy)
2
Bias in News Media
2
Self-Regulation of Media
2
Impact Assessment & Outcome Evaluation
2
Female Journalists & Media Workers
2
Gender Representation & Stereotypes in the Media
2
COVID-19 Communication
2
International Radio Broadcasting, Foreign Radio Broadcasting
2
Safety of Journalists, Safety Risks of Media Workers
2
Photojournalism
2
Election Reporting
2
Media Assistance
2
Diversity & Pluralism in Media / Communication
2
Stereotypes in Media & Communication
2
Media & Information Literacy
2
Confidential Sources, Whistleblowing, Protection of Journalists' Sources
2
Law Enforcement, Litigations, Legal Practice, Case Law, Jurisdiction
2
People with Disabilities: Reporting & Media Representation
2
Coughlin, Charles (1891-1979)
2
Conflict & War Photography
2
Fascism
2
Hindu Nationalism
2
Populism
2
Influence of Media on Politics
2
National Identity & Media, Nationalism & Communication
2
Media Effects
2
Manipulation
2
Interreligious Dialogue
2
Religious Discrimination, Persecution of / Violence Against Religious Groups
2
Research Methods
2
Discrimination
2
Countering Discrimination & Racism
2
Ethnic Groups, Ethnic Minorities
2
Rohingya
2
Dalits
2
Technologies: Impact Assessment
2
Television
2
Youth Cultures, Youth Milieus, Youth Identities
2
Youth & Digital Media
2
Access to Public Information, Freedom of Information, Right to Information
1
Digital Divide, Digital Inequalities
1
Advocacy Campaigns
1
Gender Advocacy & Empowerment, Gender Mainstreaming
1
Digital & Social Media Use: Children
1
Interactive Radio: Audience Participation, Interaction & Feedback
1
Media Use: Youth
1
Religious Media Use, Religious Media Audiences
1
Campaigning
1
Campaign Strategies
1
Digital Media Campaigns
1
Catholic News Agencies, Catholic News Services
1
Child Protection, Protection of Minors
1
Digital Literacy: Children
1
Protestantism (Mainline)
1
Aesthetics in Film & Visual Communication
1
Freedom of Expression Principles
1
Press Freedom & Communication Rights Violations
1
Surveillance, Surveillance Technologies, Spyware
1
Crisis Communication
1
Foreign Government Communication Interventions
1
Military: Communication Strategies & Practices
1
Nonprofit Public Relations: Design & Implementation
1
Street Papers
1
Discussion Forums, Community Discussions, Citizen Consultations
1
Participatory Communication
1
Conflicts, Conflict Prevention & Management, Mediation, Peacebuilding
1
International Conflicts
1
Human Rights Protection & Violations: Media Representation & Reporting
1
Media Law & Regulation in Conflict Areas
1
Violence in the Media: Reception & Effects
1
Contents of Media
1
Content Analysis (Research Method)
1
Discourse & Discourse Analysis
1
Media Quality
1
Media Monitoring, Media Observatories
1
Digital Anthropology, Cyberanthropology
1
Collective Identities & Media
1
Collective Memory: Violent Conflicts & Wars
1
Development Assistance
1
Good Governance
1
Edutainment Radio Programmes
1
Influence of Media on Development Aid
1
Algorithms & Big Data
1
Darknet
1
Digital Media Research, Digital Communication Research
1
Mailing Lists
1
Digital Political Communication
1
Social / Digital Media and ICTs in Disaster & Humanitarian Crisis Management & Prevention
1
WhatsApp
1
Yala-Young Leaders (Social Networking Website)
1
Trolling (Social Media)
1
Websites
1
Ethnic / Minority Online Communities & Websites
1
Gender and ICTs / Internet
1
LGBT & Communication / Media
1
Minorities
1
Earthquakes, Floods, Tsunamis, Natural Disasters
1
QAnon (Conspiracy Narrative)
1
Stop.Fake.org (Internet Portal, Kiev)
1
Deepfakes (Realistic-Looking Media Content that has been Modified, Generated or Falsified Using AI)
1
Effects of Disinformation on Democracy
1
Gendered Disinformation
1
Health Disinformation & Misinformation
1
Reporting on Disinformation & Misinformation
1
Curricula: School Education
1
Educational Policies
1
Secondary Education
1
Humour, Parody, Satire
1
Accountability & Transparency of the Media
1
Image Ethics, Ethics in Photojournalism
1
Journalism Ethics
1
Evaluation Criteria, Evaluation Indicators
1
Evaluation Methods, Evaluation Tools
1
Evaluation Methods: Using Communication Tools
1
Gender Discrimination, Gender Inequalities
1
Gender Relations
1
Gender-Sensitive Journalism
1
Gender-Sensitive Language
1
Revenge Porn (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images)
1
Sexuality
1
Women (General)
1
Suicide Reporting & Media Representation
1
Vaccination Campaigns & Vaccine Hesitancy
1
History of Radio
1
Indigenous Languages
1
Intercultural Dialogue
1
Media Law & Regulation: International Standards & Practices
1
Satellite Television
1
International Relations
1
International Organizations
1
Council of Europe
1
United Nations (UN)
1
United Nations Development Programme (UNDP)
1
Journalistic Quality
1
Journalists
1
News Agencies
1
Radio Journalism
1
Court Reporting & Media Representation of Judicial System
1
Political Reporting
1
Judaism: Media Representation & Reporting
1
Metaphors
1
Local Communication & Media
1
Media Assistance: Media & Information Literacy
1
COVID-19 Pandemic: Effects on Journalism, Media & Communication
1
Crowdsourcing
1
Presentation of Information
1
Interpersonal Communication, Interpersonal Relations
1
Media, Mass Media
1
Trust Building: Role of Communication & Media
1
Media & Communication Policies
1
Post-Socialist Media Systems & Landscapes
1
Civil Rights
1
Human Rights Violations
1
Regulatory Bodies
1
Religious Freedom
1
Television Law & Regulation
1
Media Companies, Media Corporations, Media Enterprises
1
Diasporas
1
Popular Music
1
Photography
1
Documentary Photography
1
Civic Engagement, Citizen & Community Participation
1
Governance
1
Government
1
Election Campaigns: Social Media
1
Election Monitoring
1
Media Capture, Vested Political & Other Interests in the Media
1
Political Role & Influence of Radio, Radio & Democratization
1
Political Television Programmes & Political Talkshows
1
Public Opinion
1
Newsletters
1
Public Media, State Media
1
Radio Debates, Radio Talk Shows, Call-In Radio Programmes
1
Emotions in Communication & Media
1
Helplines, Hotlines
1
Media Psychology, Communication Psychology
1
Parasocial Interaction
1
Indoctrination
1
Prejudices
1
Religion and Communication
1
Hinduism and Communication
1
Islamic Cultures: Role of Media
1
Muslim Digital Media & Online Communities
1
Muslim Media
1
Muslim Press
1
Muslim Television Broadcasting
1
Symbols: Religious
1
Yazidism, Yazidis, Yezidis
1
Social Conflicts, Social Problems
1
Assassination
1
Government Crimes
1
Violence
1
State Violence
1
Youth Violence & Violence Prevention
1
Civil Society
1
COVID-19 Pandemic: Economic, Political and Social Effects
1
Ethnocentrism
1
Computer Networks, Local Area Networks (LAN)
1
Software Security
1
SMS
1
Al-Manar (Television Channel, Lebanon)
1
RT (Russian International Broadcaster, formerly Russia Today)
1
Youth Activism, Youth Civic Engagement, Youth Political Interests, Youth Protests
1
Youth, Adolescents
1
Language
Document type
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Methods applied
Journals
Output Type
Information Manipulation in Sudan: A Baseline Assessment of Actors, Narratives and Tactics
Thomson Foundation (2026), 81 pp.
"The destruction of Sudan’s established information infrastructure at the outset of the conflict in April 2023 has created an environment where systematic information manipulation and disinformation campaigns now flourish unchecked. This has intersected with increasing systematic information manip
...
Platform Problems and Regulatory Solutions: Findings from a Comprehensive Review of Existing Studies and Investigations
Top Insights
Paris: UNESCO; Research ICT Africa (2023), 17 pp.
"The proliferation of hate speech and disinformation on online platforms has serious implications for human rights, trust and safety as per international human rights law and standards. The mutually-reinforcing determinants of the problems are: ‘attention economics’; automated advertising system
...
Un lexique de discours haineux et incendiaire en République Centrafricaine
Top Insights
Washington, DC: PeaceTech Lab; United States Institute of Peace (USIP); Association Jeunesse en Marche pour le Développement en Centrafrique (AJEMADEC) (2021), 38 pp.
"Depuis 2014, PeaceTech Lab a entrepris des recherches et travaillé avec des partenaires locaux dans 13 pays pour comprendre la dynamique des discours de haine et le lien entre la prolifération des récits haineux en ligne et les événements violents hors ligne. Cette recherche et les lexiques qu
...
"The report is split into three chapters: chapter one looks at over one hundred different campaigns, highlighting effective and successful campaigns, and the evaluations of them where possible. Those that are not evaluated can be used as inspiration. The categorisation of the different campaigns was
...
A matter of perception? Investigating subjective and objective exposure to hate speech with a survey and mobile longitudinal linkage study
Information, Communication & Society (2025), 21 pp.
"An increasing number of media users report frequent encounters with hate speech on the internet. Content moderation is only effective when the applied criteria align with users’ perceptions of hate speech. To explore what media users perceive as hate speech and which factors influence this percep
...
Von Hashtags und Geschichte: Vergangenheitsbezogene Hate Speech und ihre Multimodalität auf TikTok
Publizistik, volume 70 (2025), pp. 261-287
"Die audiovisuelle Plattform TikTok bildet mittlerweile einen relevanten Aushandlungsort für soziale Gruppen aller Art. User*innen bietet sich die Möglichkeit, eigene Räume für Vernetzung zu schaffen und Identitätsmanagement zu betreiben. Aufgrund der Plattformaffordanzen – vor allem Multimod
...
Online Radicalization and Ways to Counteract its Impact
Tbilisi: Social Justice Center (2024), 16 pp.
Countering violent extremism through internet intermediaries: A typology for cross-country comparison
Global Media and Communication, volume 20, issue 1 (2024), pp. 3-22
"This paper examines the counter-violent extremism and anti-terrorism measures in Australia, China, France, the United Kingdom and the United States by investigating how governments leveraged internet intermediaries as their surrogate censors. Particular attention is paid to how political rhetoric l
...
Die unbequeme Vergangenheit: Vom Umgang mit Staatsverbrechen in Russland und anderswo
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Sonderausg. (2024), 598 pp.
"Die Sowjetdiktatur war von Staatsverbrechen kaum vorstellbaren Ausmaßes geprägt. Insbesondere gilt dies für die Periode von der Oktoberrevolution 1917 bis zum Tod Josef Stalins 1953: Sie umfasst den Bürgerkrieg, die sogenannten Säuberungen, das Gulag-System und zahlreiche weitere Akte massiver
...
Antisemitismus in den Sozialen Medien
Top Insights
Opladen et al.: Verlag Barbara Budrich (2024), 329 pp.
"Soziale Medien haben die Verbreitung von Antisemitismus revolutioniert. Algorithmisch verstärkt verbreitet sich Antisemitismus auf den Plattformen in Sekundenschnelle, kostenlos und global. Die daraus resultierende Gefahr für Jüdinnen*Juden ist eine große gesellschaftliche Herausforderung. Das
...
Combatting online hate: Crowd moderation and the public goods problem
Communications: The European Journal of Communication Research, volume 49, issue 3 (2024), pp. 444-467
"Hate is widespread online, hits everyone, and carries negative consequences. Crowd moderation—user-assisted moderation through, e. g., reporting or counter-speech—is heralded as a potential remedy. We explore this potential by linking insights on online bystander interventions to the analogy of
...
Propaganda in focus: Decoding the media strategy of ISIS
Humanities & Social Sciences Communications, volume 11, issue 1123 (2024), 12 pp.
"This investigation employs the analytical framework established by Braddock and Horgan to conduct a comprehensive content analysis of 79 official English-language propaganda videos disseminated by ISIS, with the objective of quantifying the thematic composition and the evolutionary trajectory of IS
...
Methods, Techniques and AI Solutions in the Age of Hostilities. Online Hate Speech Trilogy, vol. III
Covilhã; Cali: LABCOM; Editorial Universidad Icesi (2024), 222 pp.
Legal Challenges and Political Strategies in the Post-Truth Era: Online Hate Speech Trilogy - vol II
Covilhã; Cali: LABCOM; Editorial Universidad Icesi (2024), 186 pp.
Living hated: Everyday experiences of hate speech across online and offline contexts
Communications: The European Journal of Communication Research, volume 49, issue 2 (2024), pp. 243-262
"The article builds on current research into the effects and harms of hate speech in the lives of its victims. It introduces the anthropological concept of everyday violence to focus on hate speech as an everyday experience as opposed to a sequence of separate hate speech acts. Methodologically, the
...