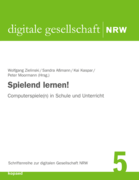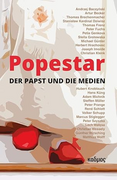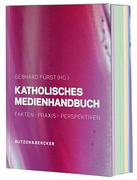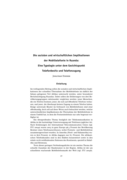Filter
17
Text search:
Peter
Kann
Featured
Free Access
7
Quick Overview
1
Topics
Community Radios
2
Digital Political Communication
2
Disinformation, Misinformation, Fake News
2
Politics and Media
2
Democracy / Democratization and Media
2
Access to Internet & Digital Communications
1
Digital Activism, Cyber Advocacy
1
Mobile Phone Use
1
Catholic Church and Communication
1
Catholic Media
1
Benedict XVI (Pope)
1
Francis (Pope)
1
John Paul II (Pope)
1
Popes & Papacy: Media Representation & Communication Strategies
1
War & Political Violence in Cinema
1
Cybersecurity, Digital Safety, Privacy, Right to Privacy
1
Encryption, Cryptology
1
Religion and Conflicts, Religious Conflicts, Religious Violence
1
Conflict-Sensitive / Peace Communication
1
Media Criticism
1
Entertainment Education, Edutainment
1
Social Change & Media / Communication
1
Digital Criticism
1
Twitter & Microblogs
1
AI Reporting
1
Digitalization, Digital Transformation
1
Conspiracy Narratives, Conspiracy Theories
1
Countering Hate Speech, Disinformation & Propaganda
1
Civic Education: Use & Role of Media
1
Educational Games, Serious Games
1
Gaming, Video Games
1
Fact-Checking & Verification of Sources
1
Legitimation
1
Indigenous Communication
1
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (Colombia)
1
Indigenous Movements, Indigenous Organizations
1
Latin America: Foreign Media Representation & Image Abroad
1
Journalistic Skills
1
Drug Trafficking Reporting & Media Representation
1
Science Journalism
1
Media Assistance: Implementing Organizations
1
Media & Communication Policies
1
Media & Information Literacy
1
Friedrich Ebert Foundation
1
Democracy
1
Political Communication
1
Propaganda
1
Political Transition and Media
1
Statistical Data: Collection, Analysis & Interpretation
1
Data Protection (Computer Software)
1
Technological Change, Technological Developments, Technological Progress
1
Theories of Communication & Media
1
Language
Document type
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Methods applied
Journals
Output Type
Politik vermitteln: Legitimationsfragen in der Demokratie
Schwalbach: Wochenschau-Verlag (2012), 108 pp.
"In Zeiten der Globalisierung, in denen Komplexität und Vernetzung immer mehr zunehmen, sind politische Inhalte und politische Prozesse kaum noch zu durchschauen und die Schwierigkeiten "der Politik" diese zu vermitteln, scheinen zunehmend größer zu werden. Gelingt die Politikvermittlung jedoch n
...
Unerkannt im Netz: Sicher kommunizieren und recherchieren im Internet
Konstanz: UVK (2008), 293 pp.
"Gewerkschaften und Datenschützer fürchten um die Pressefreiheit: Immer neue Gesetze erschweren die vertrauliche Kommunikation per Internet und Telefon. Besonders stark betroffen sind Berufsgruppen, die bislang nur in Sonderfällen ausgespäht werden durften: Journalisten, Juristen und Ärzte. Doc
...
Künstliche Intelligenz im medialen Diskurs: Wird soziale Gerechtigkeit ausgeblendet?
Frankfurt am Main: Otto Brenner Stiftung (2025), 84 pp.
[.] Auf Basis von über 2.000 Artikeln aus neun reichweitenstarken Print- und Onlinemedien untersuchen die Autor*innen, welche Themen in der Berichterstattung über KI gesetzt, wie Bezüge zu Fragen sozialer Gerechtigkeit hergestellt werden, welche narrativen Muster sich zeigen und welche Akteur*inn
...
Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert
Hamburg: Meiner (2021), 175 pp.
"Die völlige Computerisierung der Lebenswelt entwickelt eine geradezu mahlstromartige Dynamik. Massenhaft sind die Köpfe über die Bildschirme gesenkt und starren auf vereinheitlichten Geräten auf die überall gleichen Apps. Von informationeller Autonomie
...
Fake News und Desinformation: Herausforderungen für die vernetzte Gesellschaft und die empirische Forschung
Baden-Baden: Nomos (2020), 361 pp.
"Desinformation ist eine Konstante der politischen Kommunikation. Doch mit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Brexit-Abstimmung in Großbritannien erhielten bewusst lancierte Falschnachrichten eine neue gesellschaftliche Bedeutung. Denn nun wurde sichtbar, welche
...
Wissenschafts-Journalismus: Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis
Wiesbaden: Springer VS, 6., überarb. und aktual. Aufl. (2019), xi, 214 pp.
"Dieses Handbuch enthält Werkstattberichte aus allen Medien: Wie entsteht eine größere Geschichte, wie ist eine Reportage aufgebaut? Wie funktioniert Wissenschaft im Radio, wie im Fernsehen? Wie hat das Internet alles verändert? Winfried Göpfert zeigt, wie in den Redaktionen heute gearbeitet wi
...
#meinung #macht #digital #plattformkapitalismus
ila, issue 426 (2019), pp. 4-40
"WhatsApp und Facebook werden auch in Lateinamerika massiv genutzt, vor allem aufgrund ihres vermeintlich kostenlosen Charakters. Auch dort wird das Problem der rechten Meinungsmache und der Fake News diskutiert, denn die Tatsache, dass sich die Leute heute vor allem über Werbeplattformen informier
...
Spielend lernen! Computerspiele(n) in Schule und Unterricht
Düsseldorf; München: kopaed (2017), 198 pp.
"Computerspiele sind Kulturgut. Sie sind etablierte und treibende Kraft gesellschaftlicher Transformationsprozesse in der Freizeitgestaltung und des Medienkonsums zu Unterhaltungszwecken. Aber lassen sich gerade in kommerziellen Spielen – sogenannten off-the-shelf games – auch Bildungspotenziale
...
Popestar: Der Papst und die Medien
Berlin: Kulturverlag Kadmos (2017), 312 pp.
"Immer seltener stehen päpstliche Lehrentscheidungen, Enzykliken oder Kardinalserhebungen im Fokus des öffentlichen Interesses. Immer häufiger geht es um die Person des Papstes selbst, seinen Charakter und seine Handlungen. So ist der Papst heute einer der Menschen, der weltweit am meisten fotogr
...
Gerechtigkeit durch Kommunikation: Normativität in der indigenen comunicación propia in Cauca, Kolumbien
In: Verantwortung - Gerechtigkeit - Öffentlichkeit: normative Perspektiven auf Kommunikation
Petra Werner; Lars Rinsdorf; Thomas Pleil; Klaus-Dieter Altmeppen (eds.)
Konstanz; München: UVK (2016), pp. 307-317
"Der normative Rahmen von indigener Kommunikation ist komplex und kann nur mit Blick auf die sozialen Beziehungen innerhalb der Gemeinschaften und ihrer Bezüge zu anderen Gruppen verstanden werden. Die indigenen Kommunikatoren im Cauca sehen sich
...
Katholisches Medienhandbuch: Fakten - Praxis - Perspektiven
Quick Overview
Kevelaer: Butzon & Bercker (2013), 335 pp.
"Wie kann sich Kirche in einer durch Medien bestimmten Gesellschaft noch Gehör verschaffen? Sind Kirche und Medien überhaupt kompatibel? Und wie gelingt ihr der Spagat zwischen ihrer Aufgabe authentisch zu verkündigen und sich zugleich an die Ei
...
Medien und Demokratie in Lateinamerika
Berlin: Karl Dietz Verlag (2012), 298 pp.
Zur ambivalenten Rolle von Religion in afrikanischen Gewaltkonflikten
Osnabrück: Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) (2009), 48 pp.
"Die Rolle von Religion in subsaharischen Gewaltkonflikten stellt ein weitgehend vernachlässigtes Forschungsfeld dar, besonders was generalisierende empirische Studien angeht. Eine von der DSF finanzierte Pilotstudie zur Ambivalenz von Religion in Gewaltkonflikten – der ein umfangreicheres Vorhab
...
Die sozialen und wirtschaftlichen Implikationen der Mobiltelefonie in Ruanda: Eine Typologie unter dem Gesichtspunkt Telefonbesitz und Telefonzugang
In: Daumenkultur: das Mobiltelefon in der Gesellschaft
Peter Glotz; Stefan Bertschi; Chris Locke (eds.)
Bielefeld: transcript (2006), pp. 41-59
"Trotz der Herausforderungen bei der telefonischen Erschließung abgelegener Gegenden bietet der Besitz eines Handys für Millionen individueller Nutzer im gesamten Afrika südlich der Sahara auf jeden Fall signifikante wirtschaftliche und soziale Vorteile und Möglichkeiten. Besonders wertvoll ist,
...
Afrika auf dem Weg zur Medienfreiheit
Windhoek: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) (2004), 12 pp.
"Die Neuorientierung des FES-Medienprojekts für das südliche Afrika hat also zu einer eindeutigen Konzentration auf diese drei Hauptarbeitsbereiche (politische Rahmenbedingungen, alternative Medien und Gender) geführt. Daraus folgt, dass die Stiftung konsequent auf einen Arbeitsbereich verzichtet
...
Medienentwicklung und gesellschaftlicher Wandel: Beiträge zu einer theoretischen und empirischen Herausforderung
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag (2003), 277 pp.
"Gesellschaftswandel kann - egal, ob er Politik, Wirtschaft oder Kultur betrifft - ohne die Berücksichtigung von Medien und ihrer Rolle in der Geschichte kaum mehr angemessen verstanden werden [...] Die Publikation gibt einen Überblick über Vora
...
Medienhandbuch Friedensarbeit: Filme, Videos, Dias
Köln; Tübingen: Jugendfilmclub Köln;Verein für Friedenspädagogik (1983), 440 pp.