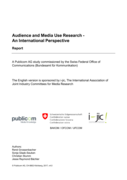Filter
3
Text search:
René
Grossenbacher
Topics
Development Journalism & Media Representation of Development Issues
2
Journalism
2
Media Landscapes, Media Systems, Media Situation in General
2
Audiences & Users
1
Audience Research
1
Audience Research: Professional Development & Joint Industry Committees (JIC)
1
Traditional Communication
1
Development and Media
1
Social Change & Media / Communication
1
Literacy, Literacy Campaigns, Postliteracy, Alphabetisation Policies
1
Journalists
1
Journalists: Professional Identity & Values
1
Working Conditions of Journalists & Media Personnel
1
Media & Communication Policies
1
Media Outlets, Media Associations
1
Language
Document type
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Methods applied
Output Type
Audience and Media Use Research: An International Perspective. Report
Bundesamt für Kommunikation (Swiss Federal Office of Communications);Publicom (2017), 121 pp.
"Currency research organisations, i.e. organisations conducting research into media use, whose results constitute a nationally valid standard (“currency”) for the advertising business, are of prime importance for developed media systems. In 2017, the global advertising market will reach a volume
...
Journalismus in Entwicklungsländern: Medien als Träger des sozialen Wandels?
Köln: Böhlau (1988), vii, 236 pp.
"[...] Unter welchen gesellschaftlichen, organisatorischen, berufsstrukturellen und personellen Bedingungen transportieren Journalisten in Entwicklungsländern den Informationsinput in publizistische Aussagen und inwiefern korrespondieren diese Bedingungen mit der "Leitidee" von Entwicklungsjournali
...
Medien und Entwicklungsprozess: Eine empirische Studie im westafrikanischen Benin
Köln: Böhlau (1987), 254 pp.