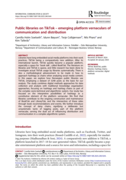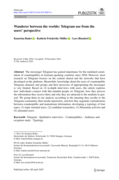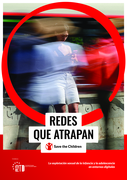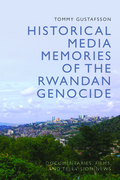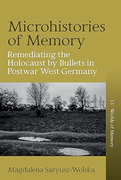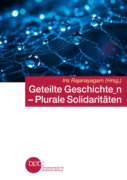Filter
2655
Featured
1136
106
16
Topics
70
65
64
64
55
51
50
49
49
48
48
46
46
46
43
43
42
41
40
39
39
38
36
36
34
34
34
33
33
32
32
31
30
30
29
29
28
28
28
28
27
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Language
Document type
277
165
126
85
75
65
58
32
30
26
17
14
13
11
10
9
8
8
7
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Methods applied
Journals
Output Type
Guía de acceso a la contratación pública para el Tercer Sector de la Comunicación
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones (2025), 85 pp.
"Esta guía ofrece una herramienta útil y práctica que facilita el acceso del TSC a las licitaciones públicas, contribuyendo a su sostenibilidad económica y fortaleciendo su autonomía e independencia. Proporciona información clara, sencilla y accesible sobre los procedimientos, requisitos y op
...
Stabiles Medienvertrauen auch in Zeiten politischer Umbrüche: Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen 2024
Media Perspektiven, issue 13 (2025), 20 pp.
"Das Medienvertrauen in Deutschland bleibt 2024 gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil und ist auch in einer langfristigen Perspektive recht robust. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist nach wie vor die Mediengattung, der am meisten vertraut wird. Das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen
...
The politics of serial television fiction: Structural developments, narrative themes, and the nonlinear turn
Bielefeld: transcript Verlag (2025), 431 pp.
"Fictional TV politics played a pivotal role in the popular imaginaries of the 2010s across cultures. Examining this curious phenomenon, Sebastian Naumann provides a wide-ranging analysis of the rapidly evolving landscape of contemporary polit-series. Proposing a novel structural model of serial tel
...
Effects of Fundraising Alliances on Charitable Donations
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing (2025), 20 pp.
"Fundraising Alliances (FAs) are independent organizations that fundraise for two or more charities under a separate brand. High-profile examples of FAs include the Disasters Emergency Committee (DEC) in the United Kingdom and the Humanitarian Coalition (HCC) in Canada. FAs are designed to reduce pr
...
Public libraries on TikTok: Emerging platform vernaculars of communication and distribution
Information, Communication & Society (2025), 20 pp.
"Libraries have long embedded social media platforms into their work practices, TikTok being a comparatively new addition. After its international launch, TikTok quickly became a popular platform, especially a space for ‘book talk’, called BookTok. The literature on libraries and TikTok is spars
...
Wanderer between the worlds: Telegram use from the users’ perspective
Publizistik, volume 70 (2025), pp. 133-155
"The messenger Telegram has gained importance for the mediated constitution of counterpublics in German-speaking countries since 2020. However, most research on Telegram focuses on the content shared and the networks that have developed on the platform. Meanwhile, knowledge about the users of counte
...
Redes que atrapan: La explotación sexual de la infancia y la adolescencia en entornos digitales
Save the Children España (2025), 94 pp.
"Con este informe, se pretende arrojar algo de luz sobre un fenómeno especialmente complejo y todavía difícil de delimitar, en parte por la falta de una definición única y por la ausencia de datos que revelen su prevalencia real, pero también en parte por la normalización de determinadas cond
...
Zwischen Wertschätzung und Widerstand: Algorithmische Kompetenz junger Menschen am Beispiel der Kurzvideoplattform TikTok
Hamburg: Hans-Bredow-Institut (2025), 64 pp.
"In der vorliegenden Studie wurde untersucht, was Jugendliche und junge Erwachsene über die Funktionsweise des algorithmischen Empfehlungssystems (AES) von TikTok wissen, inwiefern sie damit interagieren und welche Emotionen dabei involviert sind. Dazu wurden sechs Fokusgruppen (n=31) in drei deuts
...
Zwischen Bildschirmzeit und Selbstregulation: Soziale Medien im Alltag von Jugendlichen
Düsseldorf: Vodafone Stiftung Deutschland (2025), 44 pp.
"Soziale Medien sind aus dem Alltag junger Menschen in Deutschland nicht mehr wegzudenken: Ein großer Teil (69 %) der Jugendlichen verbringt mehr als die vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit empfohlenen zwei Stunden täglich am Bildschirm (vgl. BIÖG, o. D.). Davon weisen 27 % eine tägl
...
Intelligence artificielle et robotique autonome: Enjeux et défis contemporains dans l’espace francophone
Paris: L'Harmattan (2025), 358 pp.
"Cet ouvrage propose une analyse nuancée des transformations induites par l'IA et la robotique autonome dans l'espace francophone. Il insiste sur son potentiel à façonner durablement les sociétés contemporaines. S'appuyant sur des exemples concrets et des études de cas, l'ouvrage fournit un ca
...
News Can Help! The Impact of News Media and Digital Platforms on Awareness of and Belief in Misinformation
International Journal of Press/Politics, volume 29, issue 2 (2024), pp. 459-484
"Does the news media exacerbate or reduce misinformation problems? Although some news media deliberately try to counter misinformation, it has been suggested that they might also inadvertently, and sometimes purposefully, amplify it. We conducted a two-wave panel survey in Brazil, India, and the UK
...
Southern European press challenges in a time of crisis: A cross-national study of Bulgaria, Cyprus, Greece and Malta
Journalism, volume 25, issue 11 (2024), pp. 2420-2439
"The implications of the COVID-19 pandemic for newsrooms across the world range from severe economic hardship to increased threats to press freedom. The “perfect storm” that engulfed the media and journalists globally has threatened and continues to challenge their existence, and the core of the
...
Historical Media Memories of the Rwandan Genocide: Documentaries, Films, and Television News
Edinburgh: Edinburgh University Press (2024), xii, 297 pp.
"The Rwandan genocide is the second most audio-visually recreated genocide after the Holocaust, with approximately 200 films and documentaries produced in 39 countries between 1994 and 2021. Historical Media Memories of the Rwandan Genocide studies the construction, the development, and the recreati
...
The Global Faith and Entertainment Study: A Study of Attitudes and Perceptions Regarding Faith and Religion in Entertainment
HarrisX; Faith & Media Initiative (2024), 25 pp.
"The study seeks to understand consumers’ and decisionmakers’ perspectives on how current entertainment media treats themes of faith, religion and spirituality in its narratives and characters, if there is a market for more accurate and diverse representation of faith, and what opportunities exi
...
Microhistories of Memory: Remediating the Holocaust by Bullets in Postwar West Germany
New York; Oxford: Berghahn (2024), xxxii, 244 pp.
"The West German novel, radio play, and television series, Through the Night (Am grünen Strand der Spree, 1955-1960), which depicts the mass shootings of Jews in the occupied Soviet Union during World War II, has been gradually regaining popularity in recent years. Originally circulated in post-war
...
Non-News Websites Expose People to More Political Content Than News Websites: Evidence from Browsing Data in Three Countries
Political Communication, volume 41, issue 1 (2024), pp. 129-151
"Most scholars focus on the prevalence and democratic effects of (partisan) news exposure. This focus misses large parts of online activities of a majority of politically disinterested citizens. Although political content also appears outside of news outlets and may profoundly shape public opinion,
...
Threats to press freedom and journalists' safety: A comparative study of Greece, Slovakia, and Spain
"Free journalism is indispensable for monitoring the actions of political representation, holding it accountable, exposing the misuse of power, and defending public interests. Fulfilling these roles assumes that journalists can do their job and pursue public-interest stories to the best of their abi
...
Hybrid Investigative Journalism
Cham: Palgrave Macmillan (2024), xiv, 203 pp.
"This book explores entrepreneurial attempts to combine traditional investigative journalism with alternative ways of organising this work. It transcends watershed investigative projects in favour of the ways in which new actors (citizens, technologists, bloggers and local reporters, among others) j
...